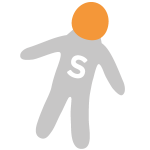Die gelbe Farbe ist noch nicht ganz trocken, aber sie verändert schon jetzt den Eindruck der ganzen Straße. An den Absperrbaken hängen Blumen und Ballons. Als Dankeschön halten FahrradaktivistInnen von Changing Cities Tulpen in den Händen und überreichen sie Bauarbeitenden, die Fahrspuren sperren und temporäre Radwege errichten.
Wäre da nicht eine Pandemie, könnte man meinen, der Streit zwischen Auto und Fahrrad sei vorüber. Es scheint als hätten unsere Städte den Umstieg auf einen nachhaltigen und emissionsfreien Verkehr vollbracht, zumindest temporär. Ein paar Pylonen oder Absperrbaken, ein bisschen Farbe et voilà. Es braucht nicht viel, um Radwege zu schaffen, das haben Städte weltweit während der Corona-Pandemie bewiesen. Doch das Konzept der Pop-up-Radwege gab es schon vorher und das ist ein entscheidende Faktor für ihren Erfolg.

Pop-up-Radwege staatlich gefördert
“Pop-Up”, ist ein englischer Begriff, der uns allen aus dem Internet bekannt vorkommt. Zum Beispiel von Werbeanzeigen. “(Plötzlich) auftauchen” oder “erscheinen”, so erklärt der Duden den Anglizismus. Ähnlich funktionieren die Pop-up-Radwege. Pop-Up ist aber auch ein Begriff, der mit dem Begriff Tactical Urbanism in Verbindung steht. Hierbei werden in einer “bottom-up” Bewegung kostengünstige, temporäre Veränderungen vorgenommen als Alternative zu lange andauernden Planungsverfahren. Kurzzeitige Projekte, die eine langfristige Wirkung haben sollen (Mehr dazu: Schneller und günstiger: Pop-up-Radwege für die Verkehrswende in der Stadt).
In Neuseeland wurden schon vor der Covid-19-Pandemie Tactical Urbanism Projekte staatlich unterstützt. In Folge der Corona-Pandemie wurde die Regierung international bekannt, weil sie dafür eine 90-prozentige Förderung für Städte versprach. Noch früher sorgte die kolumbianische Hauptstadt Bogotá für Schlagzeilen. Das Fahrrad spielt hier schon lange eine wichtige Rolle. Seit 1974 gibt es dort wöchentliche “Ciclovías”, bei denen rund 70 Kilometer Straße für den Autoverkehr gesperrt werden und die Stadt zu einem Schlaraffenland für Menschen wird. Zu Beginn der Pandemie hat die Stadt den Einsatz von Pop-up-Radwegen im April 2020 neu für sich entdeckt.
Bogotá als Best-Practice-Beispiel
Bogotá ist zwar das jüngste Beispiel, erfunden hat die Stadt die Idee der Pop-up Radwege aber nicht. 2016 erschienen sie zum ersten Mal im vom kolumbianischen Verkehrsministerium veröffentlichten Handbuch zur Errichtung von Radwegen. Als Ursprung der Idee wird die Stadt New York genannt. Dort wurde 2007 das “pavement to plaza” Programm gestartet. Damit verfolgte die Stadt das Ziel, durch “Pop-Up Plazas” temporär in öffentlichen Räumen Platz für Menschen zu schaffen.
#tacticalurbanism and #quick build for better street: #Broadway at Columbus Circle #NewYork / 2009. pic.twitter.com/R4OekGwbEr
— Benjamin Pradel (@Benjamin_Pradel) April 29, 2016
Die Pandemie als Policy Window
Dass bereits bekannte Policies und Ideen wieder auf die politische Agenda kommen, ist kein seltenes Phänomen. Grund dafür sind sogenannte Policy Windows. Öffnet sich ein Policy Window, ist die Umsetzung bereits ausgearbeiteter Konzepte (auch Policies genannt) möglich. Häufig öffnen sich Policy Windows in Krisensituationen und ermöglichen eine schnelle Umsetzung bereits ausgearbeiteter Konzepte, die dann in kurzer Zeit Probleme lösen sollen. Wie beispielsweise auch bei der Ölkrise in den 1970er-Jahren, als die Niederlande den Anfang einer Wende hin zu einem fahrradfreundlichen Verkehrssystem wagte und es in Deutschland autofreie Sonntage gab.
Im Rahmen der Covid-19-Pandemie waren es vor allem Bogotá und der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg in Berlin, die durch ihre Pop-up-Radwege bekannt wurden. Einer der verantwortlichen Mitarbeiter des Berliner Senats erklärte in einem Gespräch mit dem Difu (Deutsches Institut für Urbanistik), dass die Idee der temporären Radwege schon vor der Pandemie bekannt und ausgearbeitet war. Die fertigen Konzepte mussten nur noch umgesetzt werden. Während der Corona-Pandemie waren die Regierungen unter Druck. Sie mussten die Bevölkerung plötzlich vor Infektionen schützen und das Policy Window stand offen.
Fazit: Das nächste Policy Window wird kommen
Eines wird bei der Rekonstruktion des Aufstiegs der Pop-up-Radwege klar. Solche Policies (Konzepte) können weltweit Einfluss auf lokale Politiken nehmen. Umso wichtiger ist, dass der globale Wissensaustausch, der durch Webinare und Online-Konferenzen noch direkter erfolgen kann, weiterhin zu einer Verbreitung funktionierender Konzepte beiträgt. Denn eines ist sicher: In Anbetracht der Klimakrise werden sich weitere Policy Windows öffnen und Lösungen auf dringende Probleme verlangen. Oftmals müssen diese nicht teuer sein oder noch entwickelt werden, sondern sind möglicherweise bereits bekannt und liegen ausgearbeitet in einer Schublade.